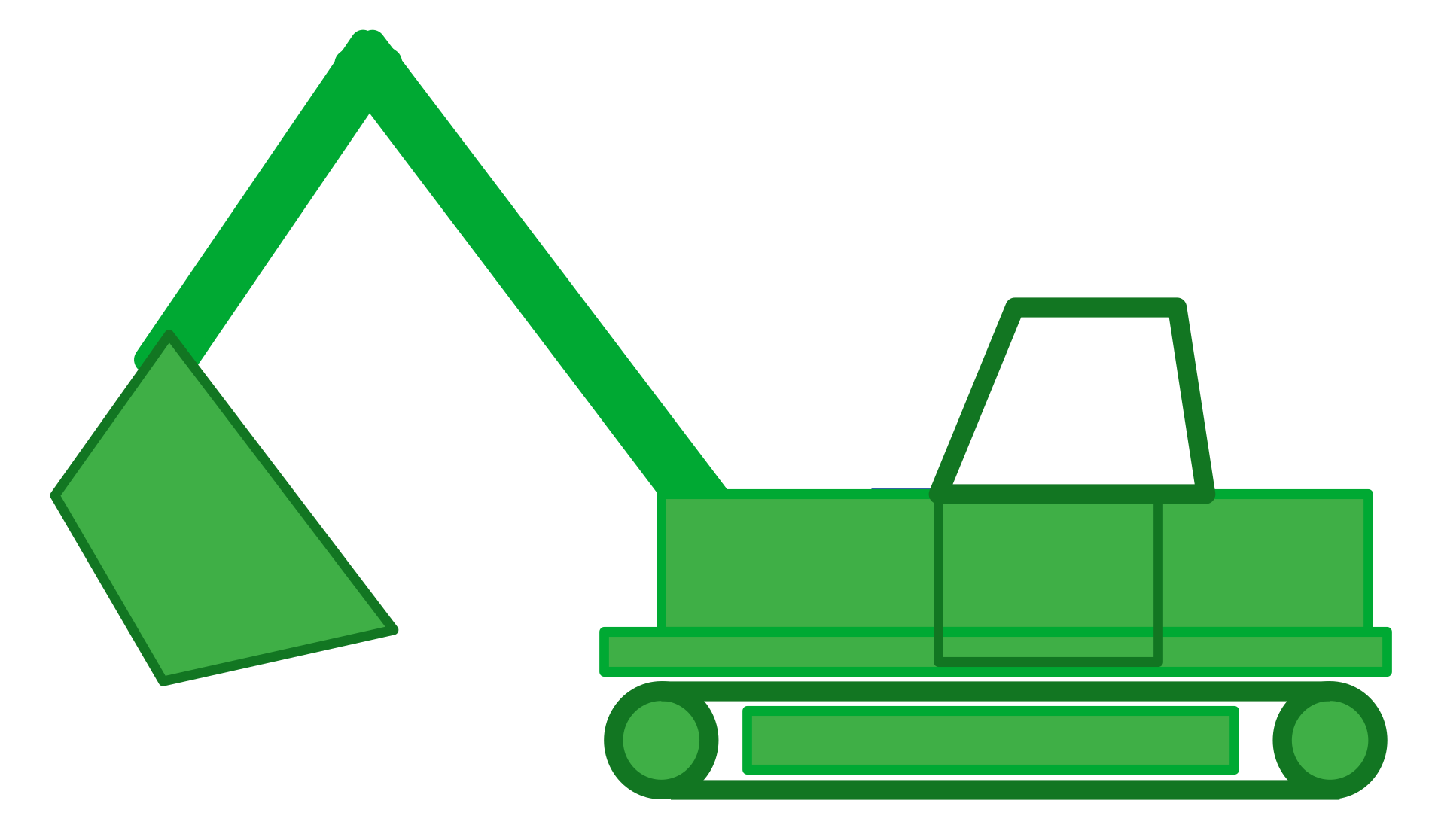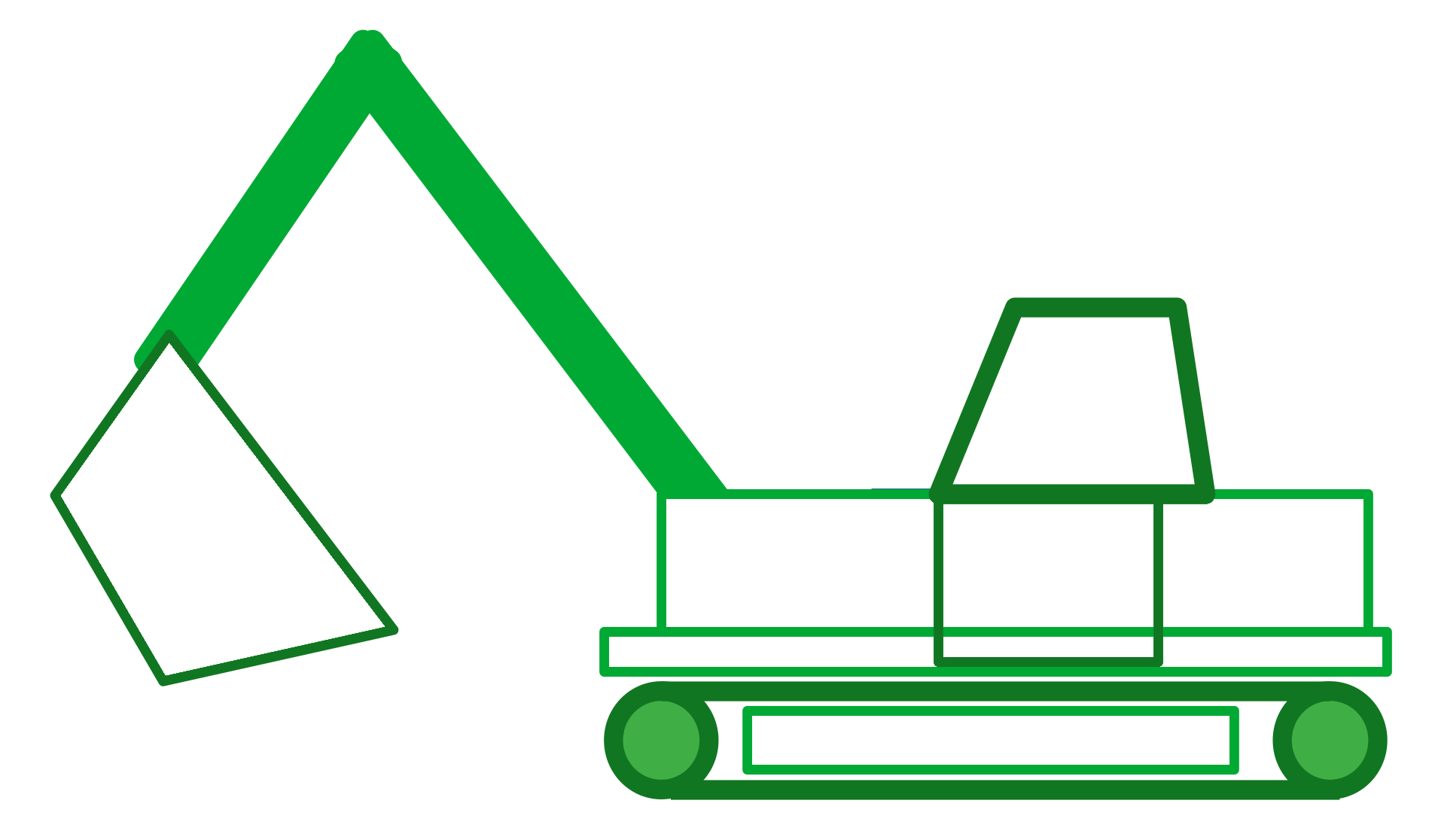Erste Hilfe gegen 'Aufschieberitis'
Formatvorlage zur Erstellung wissenschaftlicher Kurztexte0. Einleitung
Ob handgeschriebener persönlicher Brief, Anschreiben zur Bewerbung oder wissenschaftliche Hausarbeit - einen längeren schriftlichen Text zu erstellen bleibt immer etwas Besonderes. Texte zu Papier oder auf den Bildschirm zu bringen, das kann quasi im Vorübergehen passieren und es kann auch ganz große Kunst sein. Kaum ein anderes Handwerk und kaum eine andere Kunst bieten eine niedrigere Einstiegsschwelle; und die Möglichkeiten der Perfektionierung sind doch fast grenzenlos. Jeder Text, ganz gleich wie sachlich er ist, ist wie ein von uns selbst gestalteter Fußabdruck unserer Persönlichkeit. In diesem Sinne: Viel Freude beim Texten!
Der vorliegende Text sollte ursprünglich gleichzeitig Formatvorlage und Anleitung sein; deshalb ist er so aufgebaut, dass alle wesentlichen Teile eines wissenschaftlichen Textes vorkommen. Um ihn als Formatvorlage nutzen zu können, stand er ursprünglich im OpenOffice- bzw. LibreOffice-Text-Format ODT; dadurch war es möglich, die einzelnen Textteile zu lesen, später zu löschen und durch einen eigenen Text ersetzen. Inzwischen liegt das Original des Textes im HTML-Format vor; es gibt allerdings auch eine odt-Fassung und eine pdf-Fassung, die beide inhaltlich weitgehend identisch mit dem Original sind. Die odt-Fassung lässt sich weiterhin als Formatvorlage und Arbeitsgrundlage für eigene Texte nutzen; die pdf-Fassung zeigt das zu erwartende Ergebnis.
1. Über diesen Text
Moderne Computersoftware verführt mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten dazu, sich beim Schreiben von Texten in den grafischen Möglichkeiten zu verlieren und dabei die eigentlich Arbeit immer weiter aufzuschieben. Wer die Sache richtig anfängt, ...
- widmet sich zuerst vor allem dem Inhalt,
- hält sich dabei alle grafischen Optionen offen,
- setzt auf logische Formatierung: Textkörper, Überschrift, betont, ... .
2. Welche Textverarbeitungs-Software ist geeignet?
Die Ansprüche, die das Erstellen eines normalen wissenschaftlichen Textes an die benutzte Software stellt, werden heute von praktisch allen Textverarbeitungen und natürlich auch von Satzsystemen erfüllt. Der vorliegende Text wurde in der Ursprungsfassung mit dem Writer-Modul von OpenOffice 2.2 erstellt und später mit LibreOffice überarbeitet; die HTML-Fassung wurde mit gedit, einem "easy-to-use and general-purpose text editor"1) aus dem Gnome-Projekt zusammengestellt. Im vorliegenden Text beziehen sich alle konkreten Hinweise zur Bedienung auf LibreOffice. Die Vorgehensweise lässt sich leicht auf andere Textverarbeitungen übertragen. Insbesondere sollte sich das als Material vorliegende odt-Dokument auch mit anderen Textverarbeitungen nutzen lassen.
LibreOffice wird hier benutzt, weil es freie Software, per Download kostenlos auf LibreOffice.org2) verfügbar und darüber hinaus für praktisch alle aktuellen PC-Betriebssysteme verfügbar ist. LibreOffice bietet neben der Textverarbeitung eine Tabellenkalkulation, einen Formeleditor, ein Präsentations- und Vektorgrafikmodul und eine Datenbankanwendung. Wer LibreOffice nutzen möchte ohne es fest zu installieren, kann die portable Version verwenden, die speziell für den Einsatz auf USB-Stiften angepasst ist.
Diejenigen, die einen Text oder eine Arbeit schreiben möchten, die viele mathematische Formeln enthält, seien hier noch auf TEX/LATEX3) hingewiesen; dieses Satzsystem vereinfacht die Formeleingabe so stark, dass sich der für den Umstieg notwendige Einarbeitungsaufwand schnell auszahlt. „Ursprünglich wurde TeX im Jahre 1982 von Donald Knuth entwickelt.“4) Neuere LibreOffice-Versionen beherrschen den Export ins TEX/LATEX-Format und der Formeleditor von LibreOffice ist im Hinblick auf die Eingabe weitgehend TEX/LATEX-kompatibel.
3. Formatierung
3.1. Warum Formatvorlagen
Beim Formatieren sollten stets logische Textauszeichnungen (Überschrift, Fußnote, Hervorhebung, Textkörper) und nicht physikalische Formatierungen (Fettsatz, Schriftgröße) im Vordergrund stehen. Für Absätze, Zeichen, Rahmen, Seiten und Listen gibt es in LibreOffice Formatvorlagen. Mit Hilfe dieser Formatvorlagen kann man sehr einfach und schnell - um nur zwei Beispiele zu nennen - allen Kapitelüberschriften eine neue Schriftgröße oder allen Hervorhebungen eine einheitliche Farbe zuordnen. Dazu sollte man zu Beginn - in der Praxis vielleicht eher nach und nach - festlegen, welche logischen Formatierungen benötigt werden.
3.2. Formatvorlagen ändern
Dieser Text stellt sinnvolle Formatvorlagen für wissenschaftliche Kurztexte zur Verfügung. Einzelne oder sogar alle Formatvorlagen der von mir zur Verfügung gestellten Vorlage dem persönlichen Geschmack und Stil anzugleichen, ist durchaus im Sinne dieser Anleitung. Mit der Funktionstaste F11 wird in LibreOffice der Editor für die Formatvorlagen aufgerufen. Durch Linksklick wird dem Text die jeweilige Formatvorlage zugeordnet; durch Rechtsklick erhält man die Möglichkeit, die Formatvorlage zu verändern.
3.3. Hervorhebungen
Hervorhebungen, die sich gut in den Lesefluss einfügen, lassen sich durch Kursivdruck realisieren. Fettdruck ist meist „viel zu aufdringlich (...), zieht direkt die Aufmerksamkeit auf sich5) und sollte nur angewendet werden, wenn die Hervorhebung schon auf den ersten Blick vor dem eigentlichen Lesen auffallen soll. Auch eine zweite Schriftart kann zum Hervorheben eingesetzt werden. Möglich ist auch, für den eigentlichen Text eine Schrift mit Serifen (Liberation Serif, Times, Linux Libertine) und für Überschriften und Hervorhebungen eine serifenfreie Schrift (Liberation Sans, Arial, Biolinum) zu verwenden. Dabei passt Liberation Sans gut zu Liberation Serif, Arial gut zu Times und Biolinum gut zu Linux Libertine. Die Liste lässt sich fast beliebig erweitern. Nur eine Notlösung für die Hervorhebung von Textstücken in gedruckten Dokumenten ist das Unterstreichen, wie es bei der Schreibmaschine oder bei handschriftlich erstellten Texten üblich ist; bei gedrucktem Text sollten Unterstreichungen allenfalls für Hyperlinks oder Überschriften genutzt werden.
4. Kapitelüberschriften und Inhaltsverzeichnis
Die Formatierung ist in der hier verlinkten odt-Vorlage so eingestellt, dass die Nummerierung der Kapitelüberschriften automatisch erfolgt. Ein Rechtsklick auf das Inhaltsverzeichnis mit anschließender Bestätigung (Linksklick) der Option Verzeichnis aktualisieren sorgt dafür, dass Änderungen ins Inhaltsverzeichnis übernommen werden.
5. Grafiken
In vielen Fällen werden zu einem wissenschaftlichen Text auch Abbildungen gehören. Sie können über Einfügen – Bild – Aus Datei ... leicht eingefügt werden. Stehen die Abbildungen im Fließtext, sollten Sie am jeweiligen Absatz verankert sein. Soll der Text neben der Abbildung fortgesetzt werden, ist der dynamische Seitenumlauf zu benutzen. Um Verankerung oder Umlauf ändern zu können, ist die Abbildung durch einen Linksklick zu markieren; anschließend gelangt man mit einem Rechtsklick in das Eigenschaftsmenü für Abbildungen.

Prioritäten setzen
6. Digitale Weitergabe von Dokumenten
Für die digitale Weitergabe von Texten hat sich das PDF-Format (portable document format) bewährt. Es gewährleistet, dass der Text beim Empfänger so dargestellt wird, wie er vom Autor erstellt und gewollt wurde - auch bei unterschiedlichen Druckereinstellungen. Andere Formate (docx, doc, odt, rtf, sxw) sind - entsprechende Absprachen vorausgesetzt - dann sinnvoll, wenn die Empfänger das Dokument selbst weiter bearbeiten sollen.
7. Hilfe suchen
Hilfe bei Problemen mit LibreOffice oder OpenOffice, aber auch mit anderen Textverarbeitungen findet man leicht im Internet. Für LibreOffice sei hier beispielhaft die Seite https://de.libreoffice.org/get-help/documentation/ genannt, auf der man Dokumentationen findet.
8. Ergänzende Software
Zur Erstellung eines wissenschaftlichen Textes dürften auch ein Grafikprogramm und ein Mindmapping-Programm hilfreich sein. Als freie Software bieten sich hier GIMP6) und Freeplane7) an. Die Auswahl bei den Bildbearbeitungsprogrammen ist nahezu unbegrenzt und gerade bei diesen Programmen steigt die notwendige Einarbeitungszeit mit den Möglichkeiten, die das Programm bietet. Es lohnt sich also, bewusst auszuwählen.
9. Literaturverzeichnis
Bier, Christoph: typokurz – Einige wichtige typografische Regeln, Version 1.7, 21. Mai 2009, https://zvisionwelt.files.wordpress.com/2012/01/typokurz.pdf, Stand 12.02.2020.
Born, Günter: OpenOffice.org 2 / StarOffice 8 für Linux und Windows, 2., überarbeitete und aktualisierte Auflage, Millin Verlag, Lohmar: 2006.
Willms, Roland, LATEX echt einfach. Das kinderleichte Computerbuch, Franzis‘ Verlag GmbH, Poing: 2001.
10. Anmerkungen
1 aus der gedit-Hilfe
2 href="https://www.libreoffice.org/download/download-libreoffice/ , Stand: 21.02.2025
3 https://www.dante.de/tex-latex-co/ , Stand: 21.02.2025
4 Willms, Roland: LATEX echt einfach, S. 8
5 Bier, Christoph: typokurz – Einige wichtige typografische Regeln, Version 1.7, 21. Mai 2009, https://zvisionwelt.files.wordpress.com/2012/01/typokurz.pdf, Stand 21.02.2025
6 https://gimp.cc/ , Stand: 21.02.2025
7 https://docs.freeplane.org/ , Stand: 21.02.2025