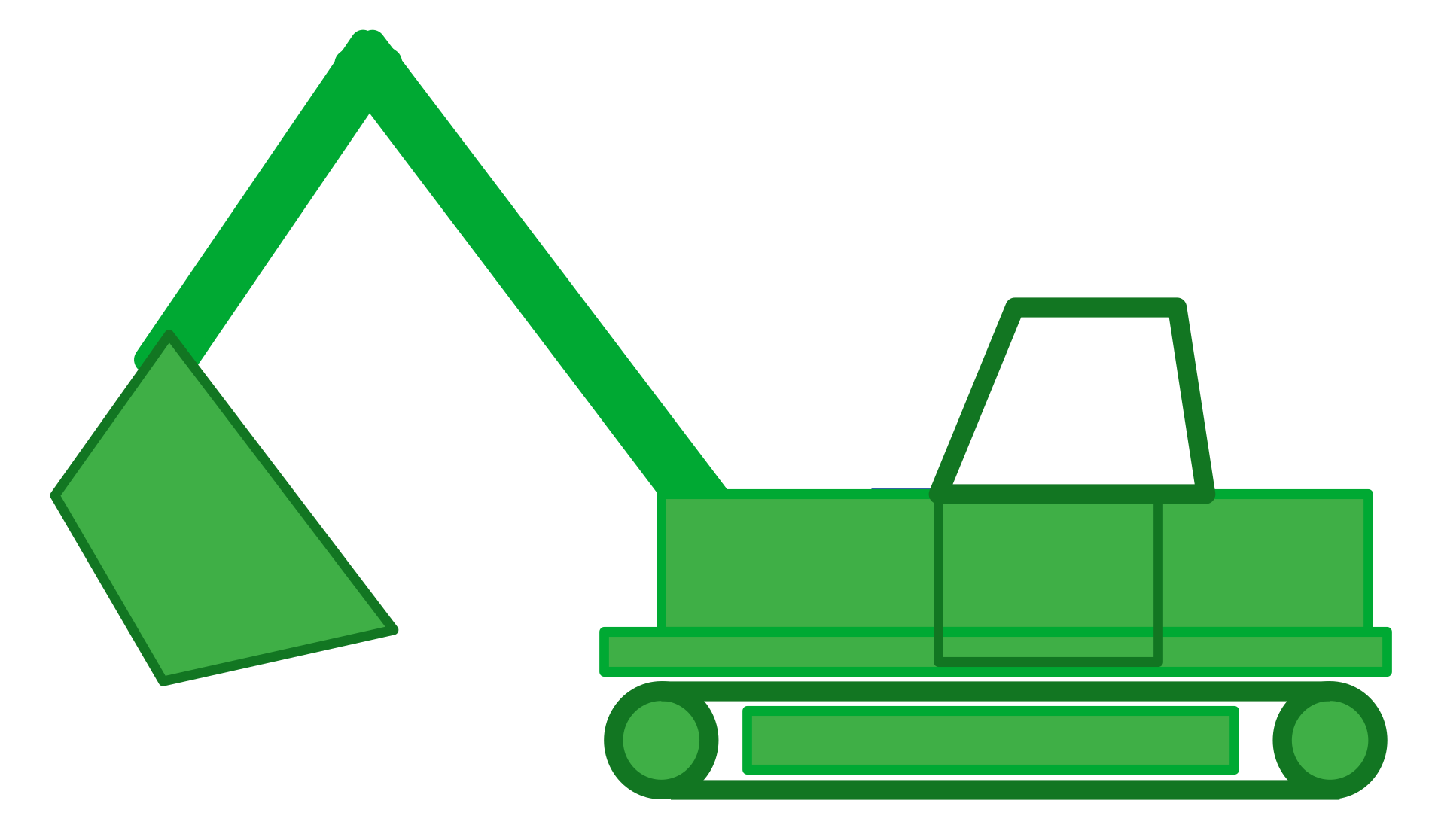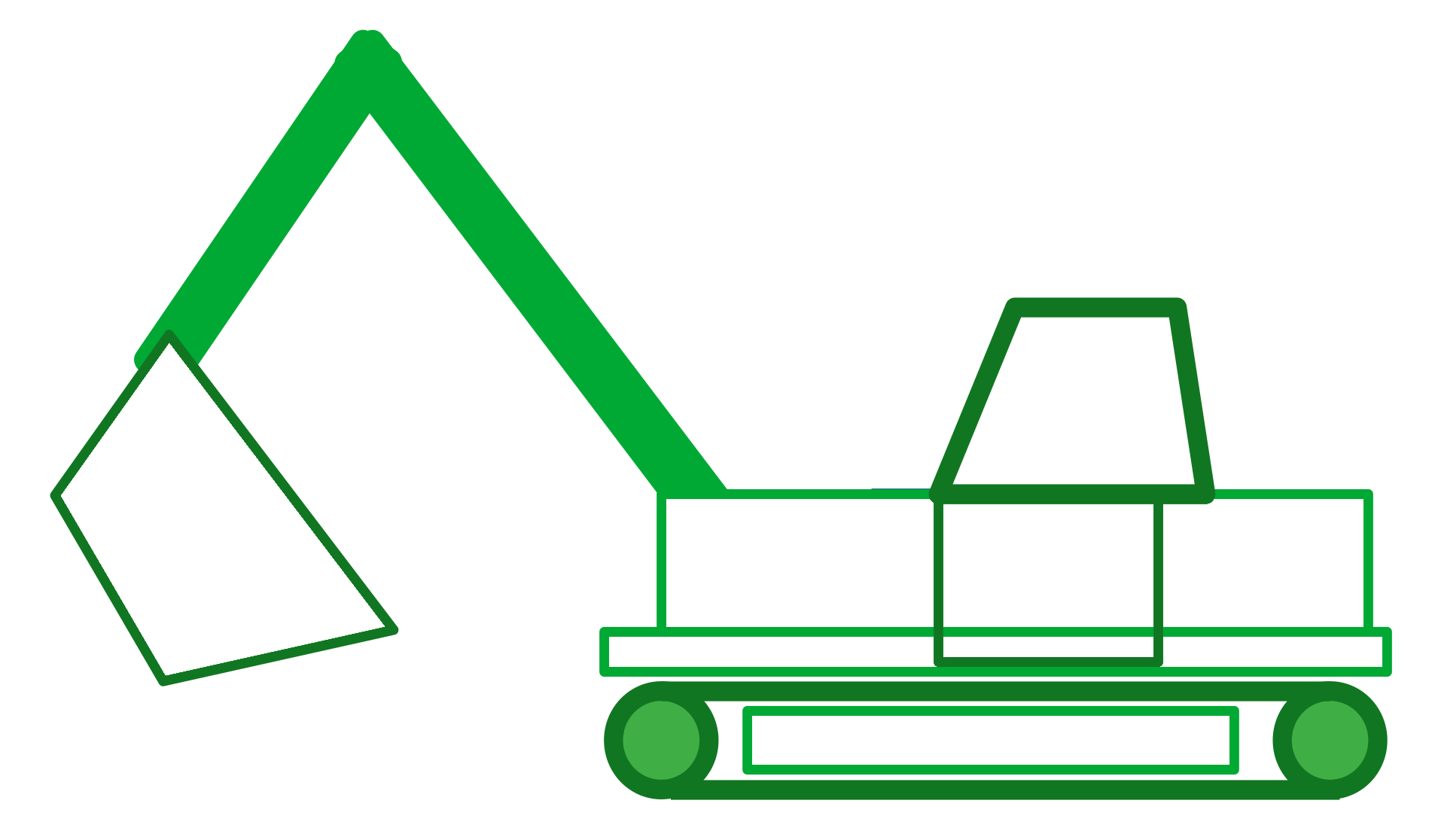Naturwissenschaftlicher Unterricht als Bestandteil christlicher Bildung und Erziehung
Niemand wird daran zweifeln, dass der Kunstunterricht und der Musikunterricht, der Deutschunterricht und der Geschichtsunterricht im Rahmen einer christlichen Schule ihre besonderen Aufgaben und Möglichkeiten haben. Beim naturwissenschaftlichen Unterricht ist das anders. Dabei können wichtige Impulse für die religiöse Bildung und Erziehung der Schülerinnen und Schüler aus dem naturwissenschaftlichen Unterricht kommen. Das Verhältnis zwischen Glauben einerseits und moderner Naturwissenschaft andererseits ist traditionell schwierig.1)
Einer der Väter der modernen Naturwissenschaft, Galileo Galilei, wurde von der Kirche wegen der Erkenntnis bestraft, dass die Erde sich um die Sonne bewegt, also nicht Mittelpunkt des Weltalls ist.2) Wenn Papst Johannes Paul II den Verurteilten 1992 nach Jahrhunderten rehabilitierte, dann hat er damit ein deutliches Zeichen gesetzt, dass diese Zeiten für immer vorbei sein sollen.
Die Wahrnehmung der Naturwissenschaften hat sich im Vergleich zu Galileis Zeiten deutlich verändert: Durch die naturwissenschaftliche Forschung haben wir Menschen ungeheuer viele beeindruckende und technisch verwertbare Erkenntnisse über unsere Umwelt gesammelt. Da liegt es nahe, dass wir auch die entscheidende Frage unseres irdischen Lebens: "Gibt es Gott?", oder anders formuliert: "Wartet auf uns nach dem irdischen Tod das eigentliche Leben?", gern von den Naturwissenschaftlern beantwortet hätten.
Lassen wir an dieser Stelle den Glanz der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse einmal in den Hintergrund treten und betrachten wir statt dessen die Naturwissenschaften selbst. Da ist zum einen ein Blick auf die Methode zu werden: Physik3) ist der Versuch, die wahrnehmbare Wirklichkeit durch Modelle möglichst effektiv zu beschreiben. Als Idealfall gilt dabei die mathematische Modellierung.
Physik beschäftigt sich also nicht mit (letzten) Begründungen, sondern mit Beschreibungen. Kausalität meint im Rahmen der Physik nur noch eine Beschreibungsstrategie - ein Gegenstück dazu ist innerhalb der Physik die Beschreibung über Erhaltungssätze. Physikalische Kausalität hat nichts mit einer echten Begründung zu tun.
Ein Beispiel macht das deutlich: "Weshalb fällt ein Stein nach unten, wenn ich ihn loslasse?" - "Wegen der Erdanziehung." Aber eigentlich ist das keine Begründung. Unter Physikern ist damit gemeint: Ich weiß, dass in allen gemachten Experimenten immer wieder festgestellt wurde, dass ein über der Erdoberfläche losgelassener Stein nach unten auf die Erdoberfläche fällt. Dieser Effekt ist im Alltag bedeutsam und physikalisch interessant; er bekam deshalb einen Namen: Erdanziehung.
Dabei haben die Physiker in den letzten gut hundert Jahren gelernt, dass die Modellbildung oftt schwieriger ist, als auf den ersten Blick erwartet:
- Manche "Dinge" können prinzipiell nicht über ein einziges Modell beschrieben werden (Welle-Teilchen-Dualismus).
- In manchen "Fällen" können nur Wahrscheinlichkeitsaussagen gemacht werden (Quantenphysik).
- Und jede Messung beeinflusst prinzipiell ihre Ergebnisse (Unschärferelation).
- Und dann mussten die Physiker noch in der Chaostheorie lernen, dass vieles, vielleicht alles berechenbar erscheint, aber nicht berechenbar ist.
Die Erkenntnismöglichkeiten der Physik haben also benennbare Grenzen.
Damit ist klar, dass die Physik schon von ihrer Methode her Gott nicht bewesen kann. Eine christliche oder gar eine katholische Physik bzw. Naturwissenschaft in diesem Sinne kann es also nicht geben. Sind die Naturwissenschaften im Rahmen einer christlichen Bildung und Erziehung also doch nur notwendiges, weil im Alltag nützliches Beiwerk? Ich meine: Nein!
Immerhin macht auch die Physik eines deutlich: die Beschränktheit menschlicher Erkenntnis. Damit nicht genug: Im Mittelpunkt der Physik, des physikalischen Experiments, steht das Natur-Phänomen, die Natur, religiös gesprochen: die Schöpfung, Gottes Werk. Zu dieser Schöpfung gehören Tiere und Pflanzen, Sonne und Mond, und auch - natürlich nicht als lebendige Wesen - die Lorentzkraft, die Planetenbewegungen und die Interferenz des Lichts an einem Gitter. Das ist durchaus keine neue Sichtweise: Schon Franz von Assisi hat in seinem Sonnengesang von "Schwester Wasser"4) und "Bruder Feuer"5) gesprochen, die Gottes Zeichen tragen.
Diese Schöpfung sollten wir nicht nur erforschen, wir sollten uns sondern auch an ihr erfreuen. Wer Physik treibt, erhält Gelegenheit, über Gottes Werk zu staunen; das ist nicht Physik, aber als Gelegenheit unausweichliche Folge des Physik-Treibens. Worüber man staunen kann: Zum Beispiel über die Schönheit Chladnischer Klangfiguren, über den Wasserstrahl, der von einer am Pullover geladenen Folie abgelenkt wird, oder über die Interferenzfarben, die entstehen, wenn das Sonnenlicht auf eine als Reflexionsgitter dienende CD fällt.

Zerlegung von Sonnenlicht in die Spektralfarben durch eine CD als (Reflexions-)Gitter
Staunen dürfen wir auch darüber, dass Gott uns die Gabe geschenkt hat, eine Mathematik- und Zahlenwelt zu entwerfen, die als - wenn auch grobes - Raster auf seine Natur passt. Es ist mehr als verblüffend, dass dieses Raster so einfach ausfällt. Nur ein Beispiel sei genannt: s = ½·g·t2 ist die Formel für den freien Fall - nicht t1,9 oder t1,7689 sondern einfach t2.
Kein physikalisches Gesetz kann uns die Entscheidung abnehmen, an Gott zu glauben oder nicht. Physik zu treiben eröffnet uns jedoch über die Schöpfung vermittelte Begegnungen mit dem Schöpfer, mit Gott.6)
Diese Begegnungen sind nicht zwingend und können auch im Unterricht nicht herbeigeredet werden. Aber wir können versuchen, naturwissenschaftlichen Unterricht so zu gestalten, dass sie möglich werden. Es ist unsere Aufgabe, die Natur so vorzustellen, dass Schülerinnen und Schüler sich an ihr freuen, über sie staunen können. Wenn das gelingt, steht nicht das Gerät, also die Technik, des Menschen Werk, im Mittelpunkt des Physikunterrichts, sondern die Schöpfung. Das ist keine Maschinenstürmerei und hier wird auch keinem esoterisch angehauchten Physikunterricht das Wort geredet: Physik brauch Technik; es geht allein um die Betonung.
Mich selbst fasziniert und erfreut nach vielen Jahren mit der Physik als Beruf immer wieder aufs Neue, wenn auf der Metallplatte über einem Lautsprecher Chladnische Klangfiguren erscheinen oder das weiße Licht der Bogenlampe hinter dem Prisma zum Regenbogen wird. Oft habe ich Schülerinnen und Schüler gesehen, die sich mit offensichtlichem Vergnügen durch auf den ersten Blick "wider-Sinn-ige" Effekte zu Neugier und Scharfsinn herausfornern ließen.7)
Gelobt seist du, mein Herr, mit allen deinen Geschöpfen,
besonders dem Herrn Bruder Sonne,
der uns den Tag schenkt und durch den du uns leuchtest.
Und schön ist er und strahlend in großem Glanz:
von dir, Höchster, ein Sinnbild.
(aus dem Sonnengesang des Heiligen Franz von Assisi8))
Schöpfung bedeutet aber für uns nicht nur Freude und Schönheit. Physikalisches Wissen gibt uns Macht übe die Schöpfung und damit Verantwortung. Ein Ziel des naturwissenschaftlichen Unterrichts im Gesamtkontext christlicher Bildung muss demnach sein, die Schülerinnen und Schüler mit Wissen auszustatten, das es ihnen erlaubt, in dieser Welt verantwortlich zu handeln und zu leben. Christliche Bildung wird Schülerinnen und Schüler auf diese Verantwortung hinweisen und zur Übernahme dieser Verantwortung motivieren. Auch das ist religiöse Erziehung.
Wo echtes religiöses Erleben nd Erziehen stattfindet, da geht es immer um beides, um Kampf und Kontemplation, Freude und Leid. Leider tun viele von uns Naturwissenschaftlern sich schwer im Umgang mit diesem Aspekt der von uns vewrtretenen Wissenschaften.
Anmerkungen
* Dies ist die geringfügig überarbeitete Fassung eines Textes, der 1997 in einer Festschrift des Gymnasiums St. Kaspar veröffentlicht wurde.
1 Der ursprüngliche Text begann mit einem Zitat von Exodus, 3.2 - 3.4. Dort heißt es: "Dort erschien ihm der Engel des HERRN in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Er schaute hin: Der Dornbusch brannte im Feuer, aber der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Mose sagte: Ich will dorthin gehen und mir die außergewöhnliche Erscheinung ansehen. Warum verbrennt denn der Dornbusch nicht? Als der HERR sah, dass Mose näher kam, um sich das anzusehen, rief Gott ihm mitten aus dem Dornbusch zu: Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich." Quelle: https://www.die-bibel.de/bibel/EUE/EXO.3/Exodus-3 , Abruf 14.02.205.
2 Eigentlich war es Nikolaus Kopernikus, der das heliozentrische Weltbild in die abendländischen Wissenschaften eingebracht hat. Galileis Verdienst i Hinblick auf das heliozentrische Weltbild lag u.a. darin, dass er durch seine Beobachtungen mit dem Fernrohr Belege für dies Weltbild finden konnte.
3 Die Physik nenenne ich hier und im Folgenden stellvertretend für die Gesamtheit der modernen Naturwissenschaften.
4, 5 https://de.wikipedia.org/wiki/Sonnengesang_(Franz_von_Assisi), Abruf 14.02.2025.
6 Die ursprüngliche Fassung dieses Artikels entstand kurz nachdem der Planet Hale-Bopp 1997 ohne Instrumente beobachtet werden konnte. Deshalb stand an dieser Stelle noch eine Erinnerung an die drei Weisen aus dem Morgenland, die durch ein Naturphänomen, den "Stern von Bethlehem" zu Jesus geführt wurden. Vgl. auch : https://de.wikipedia.org/wiki/C/1995_O1_(Hale-Bopp), Abruf 14.02.2025.
7 In der ursprünglichen Fassung stand hier weiter: Was suchten und was fanden wir, als wir ihn zum ersten Mal und dann immer wieder beobachteten? Und das, wo er "objektiv betrachtet" doch ein eher kümmerliches Bild abgibt im Vergleich zu den tollen Leuchtreklamen, von denen wir sonst umgeben sind.