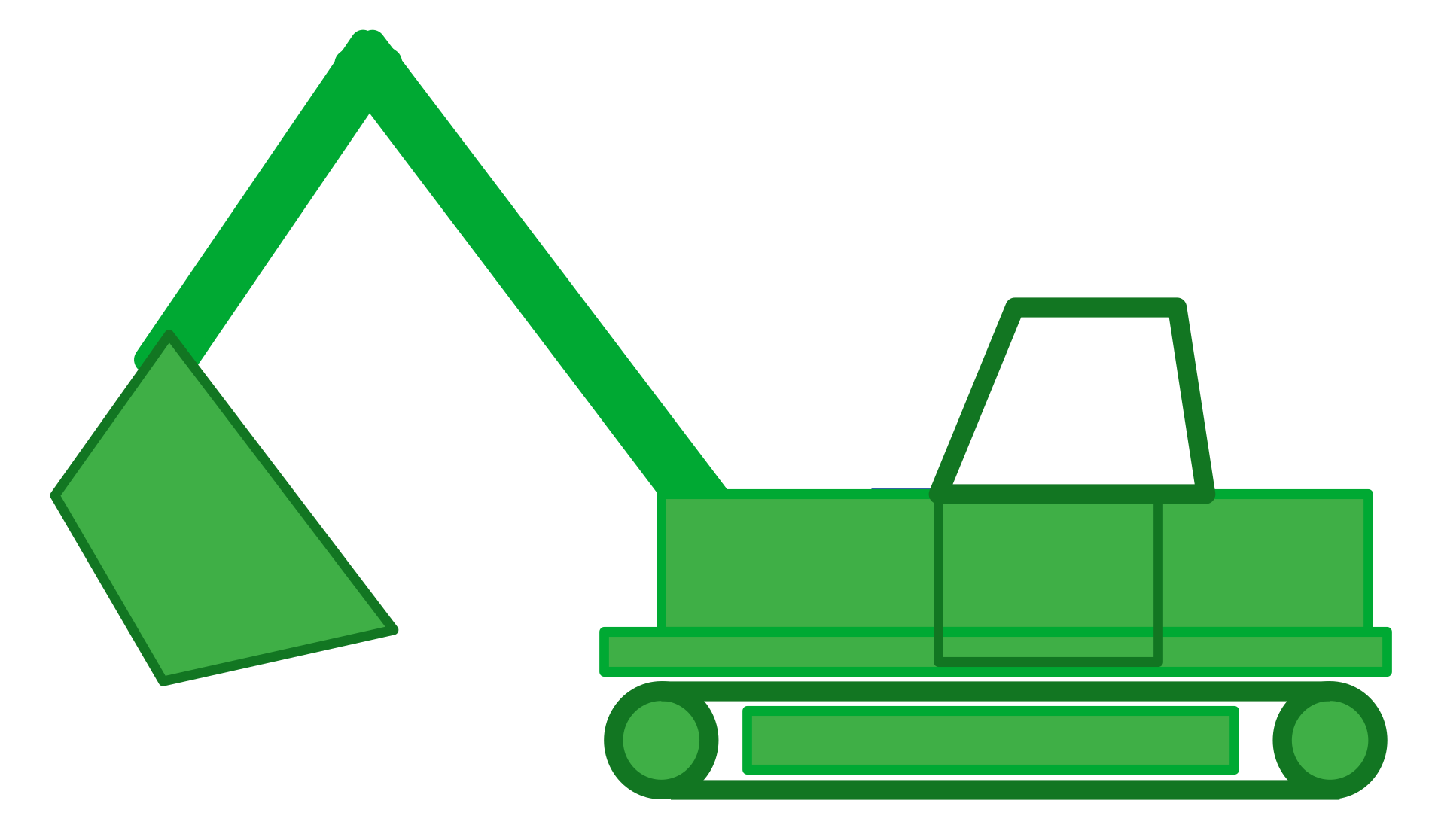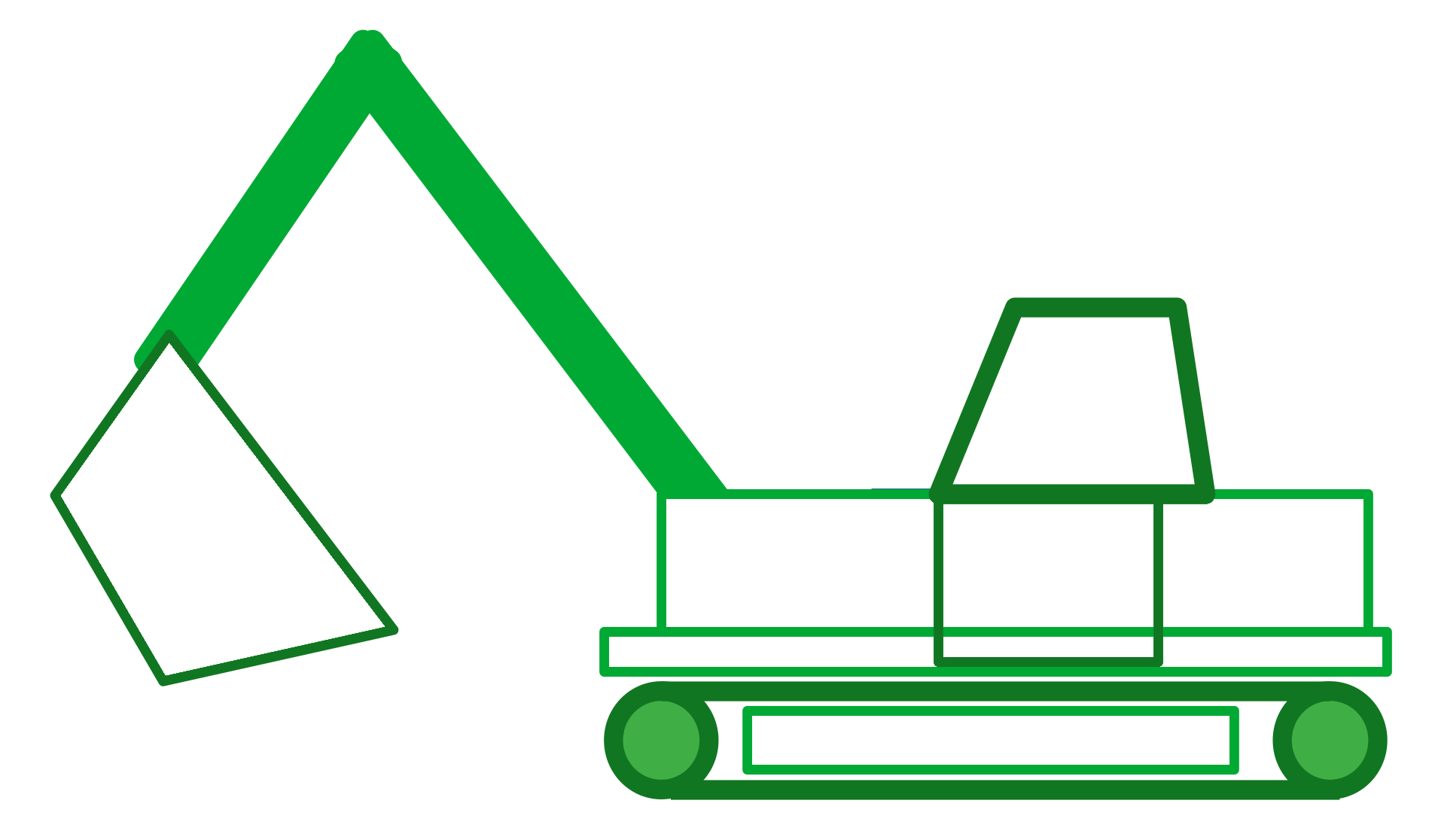Rede zum Volkstrauertag 2016
DringenbergLiebe Dringenberger Bürgerinnen und Bürger, sehr geehrte Gäste,
wie in jedem Jahr begehen wir heute, zwei Sonntage vor dem ersten Advent, den Volkstrauertag. Graue Tage, pfeifender Wind, Kälte, die zittern lässt – das Wetter lädt in dieser Zeit eigentlich nicht zu Veranstaltungen im Freien ein.
Was bewegt uns, gemeinsam heute hier zusammenzustehen und zu trauern? Welche Bilder und Töne bringen wir in unseren Erinnerungen zu dieser Trauerfeier mit? Um wen trauern wir heute? Ihre Antwort würde vielleicht ganz anders klingen als meine. Die Bilder, die uns an diesem Tages begleiten, dürfen sich unterscheiden. Jede und jeder von uns bringt seine eigenen Erfahrungen, seine eigene Familiengeschichte und seine eigenen Gefühle der Trauer mit. So stehen wir hier und die Trauer verbindet uns.
Mir fällt mein Onkel Fritz ein, den ich nie kennenlernen durfte und der mich nie kennenlernen durfte, weil er nach vielen Jahren im Krieg drei Tage vor Kriegsende in der Slowakei von Granatsplittern getötet wurde. Nach den Erzählungen seiner Geschwister war Onkel Fritz ein Mensch mit Herz, der es wohl auch faustdick hinter den Ohren hatte. Wenn er den Krieg überlebt hätte, hätte er mir wohl so manchen Blödsinn beigebracht. Ich bin sicher, dass er mir gut getan hätte. Er fehlte in unserer Familie, wie jeder Mensch, der getötet wird, da fehlt, wo eigentlich sein Platz gewesen wäre.
Erst im hohen Alter haben sich seine Geschwister anmerken lassen, wie sehr sie ihn, den großen Bruder, fast ein Leben lang vermisst haben. In der Zeit der Jugend und der besten Jahre konzentrieren sich die meisten Menschen darauf, das Leben zu bewältigen. Im Alter dann rücken erlittenes Leid, schwere Stunden und die Erinnerung an nicht mehr lebende liebe Menschen noch einmal mehr in den Vordergrund. Onkel Fritz ist jetzt über siebzig Jahre tot, ebenso wie all die anderen Menschen, die in den Schrecken des zweiten Weltkrieges und der Naziherrschaft getötet wurden. Sie wurden getötet von Hunger, Auszehrung oder gegnerischen Waffen, in ihren Häusern, auf den Schlachtfeldern des Krieges oder in den Lagern der Schreckensherrschaft, in ihrer Heimat oder ganz weit von zuhause entfernt. Und ganz gleich, wo auch immer ihre Heimat war und welchem Volk sie sich zugehörig fühlten, gab es Menschen, die sie liebten, die an ihnen hingen und um sie weinten - voller Trauer.
Trauer ist ein langwieriger Prozess, erst recht dann, wenn der Tod unter schrecklichen, dramatischen und gewaltsamen Umständen stattgefunden hat – und Krieg ist immer schrecklich, ist immer dramatisch, ist immer gewaltsam. Der Terror der Nazidiktatur, die Schrecken des Zweiten Weltkrieges und all die Grausamkeiten, die damit verbunden waren, haben vielen so die Sprache verschlagen, dass sie erst nach vielen Jahren, oft erst nach Jahrzehnten von dem erzählen konnten, was ihnen widerfahren war. Und manche Geschichte ist sicher auch auf immer unerzählt geblieben, weil die seelischen Verletzungen zu groß waren. Vielleicht gibt es auch deshalb in dieser Generation so viele Menschen, die ins Vergessen versunken und dement geworden sind.
Obwohl Kriege, Gewalt und Terror auf der Welt nicht aufgehört haben und in vielen Ländern gewalttätige Auseinandersetzungen lodern, blieben uns in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges neue schreckliche Erfahrungen dieser Art bisher erspart. Wir Nachgeborenen können dieses Glück kaum hoch genug wertschätzen und ich hoffe sehr, dass uns dieses Glück gewogen bleibt. Zwischen 1933 und 1945 dagegen gerieten die Menschen in Europa - mit oder ohne ihre eigene Zustimmung - in Situationen, in denen sie das Töten, das Getötet-werden oder auch beides entweder am eigenen Leib oder zumindest aus nächster Nähe miterleben mussten – allzuoft in den grausamsten Formen.
Das galt für die Soldaten aller am Krieg beteiligten Armeen, das galt für die Frauen, Kinder und alten Menschen, die – nicht nur in Deutschland - dem Terror der Bombennächte ausgesetzt waren und das galt mit kaum nachzuvollziehender Grausamkeit für diejenigen, die als Gefangene der Konzentrationslager zur absoluten Demütigung, zu totaler Hilflosigkeit und letztlich zu einem meist grauenvollen Sterben verdammt waren. Wir Menschen sind Wesen, die sich manchmal aus mangelndem Mut, Ängstlichkeit oder Überanpassung dazu verleiten lassen, Sichtweisen, Redensarten und Handlungen zuzustimmen, von denen wir wissen, dass sie die unteilbare Würde aller Menschen verletzen. Da wird ausgegrenzt, wer ungewohnt aussieht, vielleicht, weil er eine andere Hautfarbe hat, ausgelacht, wer ungewöhnliche Ideen ausspricht, ohne dass man bereit wäre ihm zuzuhören, und beargwöhnt, wer einer anderen Religion angehört.
Für die betroffenen Menschen ist das immer ausgesprochen schmerzhaft. Zum Glück sind die meisten menschlichen Gemeinschaften so stabil und stark, dass der Schaden in Grenzen gehalten wird, weil es mutigen Menschen gelingt, der Menschenwürde wieder zu ihrem Recht zu verhelfen. Im Deutschland der Jahre 1933 bis 1945 war das anders. Das führte zu unermesslichem Leid für nahezu unermesslich viele Opfer des Krieges und der Schreckensherrschaft.
Nur wenn wir das als einen Teil unserer Geschichte annehmen, der sich nicht auswischen, sondern nur verarbeiten und für gemeinsame Lernprozesse nutzen lässt, ist wirkliche Trauer möglich. Diese Trauer wird die noch offenen seelischen Wunden heilen und die Weitergabe der Traumatisierungen von Generation zu Generation stoppen; die Trauer wird dem Leben dienen. So ist es gut, dass wir Volkstrauertag halten. Krieg und Terror gab es nicht nur zwischen 1933 und 1945, gab es nicht nur in Deutschland – es gibt Krieg und Terror immer noch, an vielen Orten der Welt. Der Volkstrauertag gibt uns heute die Gelegenheit, aller Opfer von Terror und Gewalt zu gedenken und um sie zu trauern.
Wir müssen alles daran setzen, der Gewalt durch Versöhnungsarbeit den Boden zu entziehen – das ist für die Menschheit die einzige realistische Chance. Wir brauchen eine dem Leben zugewandte Einstellung, den offenen Blick für die Not um uns, die Bereitschaft auf Hilferufe zu hören.
Als ein Beispiel unter vielen darf ich die Flüchtlinge nennen, die nach Deutschland fliehen. Sie sind auf der Flucht vor Lebensbedingungen, in denen Gewalt und Schrecken das Bild des Alltags prägen, in denen der Ruf nach einem menschenwürdigen Leben für alle ganz und gar keine Chance hat, in denen sie vielleicht nur die Wahl haben als Soldaten zu töten oder selbst getötet zu werden. Wir dürfen uns erlauben, diese Menschen mit Gastfreundschaft, mit der Bereitschaft zur Unterstützung und mit einem Vorschuss an Sympathie aufzunehmen.
Papst Franziskus hat bei einer Begegnung mit Flüchtlingen auf der griechischen Insel Lesbos ein Gebet für die Opfer von Terror, Krieg und Verfolgung gesprochen. Mit einem kurzen Auszug aus diesem Gebet möchte ich schließen:
„Barmherziger Gott!
[...]
Auch wenn viele ihrer Gräber keinen Namen tragen,
ist doch jeder von ihnen Dir bekannt,
von Dir geliebt und erwählt.
Mögen wir sie nie vergessen, sondern ihr Opfer ehren,
mit Taten mehr als mit Worten.
[...]
Amen“1)
Dankeschön ...!